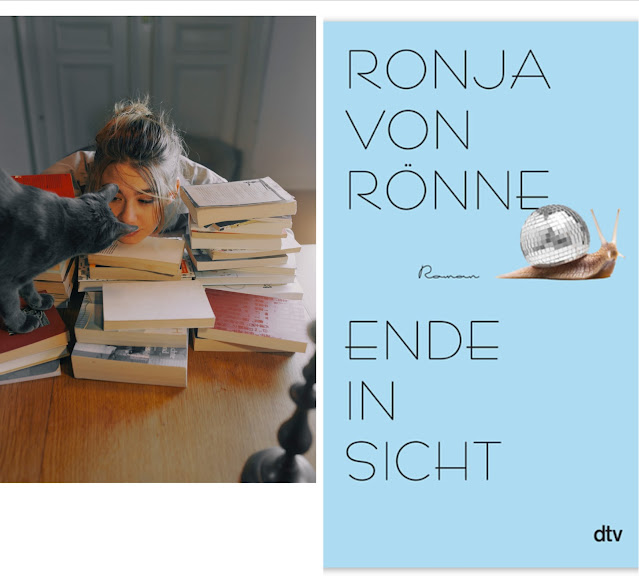Das wird man ja wohl noch sagen dürfen
Zora hatte lange darüber nachgedacht, aber am Ende kam sie immer zur gleichen Schlussfolgerung: Als Aktivist:in wurde man geboren – oder nicht.
Eine Haltung, die sie verschwieg. Vor den anderen, die immer noch glaubten, sie könnten den Zionisten, dem Klima, dem Spätkapitalismus wenigstens ein Bein stellen.
Der Gedanke, man sei entweder Aktivist oder Realist, war ihr peinlich – ein zutiefst deterministisches, hoffnungsloses Denkkonzept, das Gegenteil von allem, wofür sie sich doch eigentlich einsetzte.
Dass sie selbst zur Aktivistin verdammt war, irgendwie bleiern in die DNA gegossen, ermüdete sie.
Die Mädchen mit den blauen Haaren und dem Pueblo-Tabak gingen ihr auf die Nerven. Die Palitücher fand sie hässlich. Die sich wie Karnickel vermehrenden Buchstaben der LGBTirgendwas-Bewegung stießen sie ab. Und dass es völlig unmöglich schien, sich als Linke über irgendetwas aus den eigenen Reihen zu beschweren, kotzte sie an.
Sie war nicht geschaffen für political correctness; sie wollte mindestens Revolution – und sie wollte sich mit anderen Linken darüber lauthals streiten, wie diese auszusehen hätte. Sie sehnte sich nach Zeiten, die sie nie erlebt hatte, nach Kämpfen, die wenigstens klar gewesen wären. Nach ein bisschen Selbstironie.
Manchmal steigerte sie sich in den Gedanken hinein, sie sei nur zur falschen Zeit geboren.
Am Tresen des linken Kulturzentrums „Kollektiv" nippte sie an einem warm gewordenen Bier. Neben ihr diskutierten zwei Genossinnen über cultural appropriation innerhalb der Klimabewegung, während ein Dritter Flyer für seine neue queere Theaterperformance anpries, „Versonnen: Keine Bühne für queere Leerstellen".
Zora nickte, lächelte, sagte nichts.
In ihr wuchs das leise Gefühl, nicht mehr auf der richtigen Seite zu stehen – oder schlimmer: auf gar keiner mehr. Luftleer, ein verlabertes politisches Vakuum, das war diese Tischrunde.
Vielleicht, dachte sie, müsste man die Bewegung unterwandern, um sie zu retten. Sie ging nach Hause durch leere Straßen, vorbei an Graffiti, die einmal Wut gewesen waren und jetzt nur noch Dekoration. Der Gedanke ließ sie nicht los. Nicht als Scherz, nicht als bitterer Trost – als Plan.
Was, wenn man tatsächlich eine Gegenorganisation gründete? Innerhalb der Szene, unsichtbar, aber wirksam. Leute, die noch an Konflikt glaubten statt an Konsens, an Materialismus statt an Identität, an Macht statt an Betroffenheit.
Zora lachte laut auf, allein auf der Straße. Es klang wahnsinnig. Es war wahnsinnig.
Aber wer, außer Wahnsinnigen, hatte je etwas verändert?
Zuhause setzte sie sich an ihren Laptop, öffnete ein leeres Dokument. Ihre Finger schwebten über der Tastatur. Dann fing sie an zu tippen.
Thesen für eine neue Linke. Arbeitstitel: Unterwanderung.
Sie schrieb die ganze Nacht. Nicht schön, nicht durchdacht, aber ehrlich. Über die Therapeutisierung des Politischen. Über den Terror der guten Gefühle. Über den Unterschied zwischen Solidarität und Sentimentalität. Darüber, dass die Linke aufgehört hatte zu kämpfen, weil sie Angst hatte, jemanden zu verletzen – und dabei vergessen hatte, dass Politik immer verletzt, immer Konflikt bedeutet, immer Parteinahme. Dass all die großen Worte, Demokratie, Fortschritt, Gleichheit aus dem selben Garn gestrickt waren: Dem lauten Mut zur Wut. Den Satz löschte sie gleich wieder. Was für ein Blödsinn.
Am Morgen schickte sie den Text an drei Leute. Nicht ihre engsten Freund:innen aus dem Kollektiv, sondern die anderen. Die, die bei Plenen schwiegen. Die, die nach Treffen zynische Kommentare murmelten. Die, deren Blicke sie manchmal auffing – müde, wissende Blicke.
Zwei Tage später bekam sie die erste Antwort.
Das Café war leer bis auf sie und Marlene, die ihren Kaffee nicht anrührte und Zoras Text auf ihrem Handy scrollte. Sie war älter als Zora, Ende dreißig, hatte in den Neunzigern noch echte Hausbesetzungen erlebt, richtige Straßenschlachten, bevor alles zu Kulturzentren und Runden Tischen wurde.
„Du weißt schon, dass du damit fertig bist, wenn das rauskommt", sagte Marlene, ohne aufzusehen.
„Ich bin sowieso fertig", sagte Zora. „Ich halt das nicht mehr aus."
Marlene sah auf. In ihren Augen lag etwas, das Zora überraschte: keine Ablehnung. Erleichterung.
„Ich auch nicht", sagte sie leise. „Schon lange nicht mehr."
Sie trafen sich eine Woche später wieder, diesmal zu viert. Dann zu siebt. Keine festen Termine, keine Mailingliste, keine Namen in Protokollen oder telegram Gruppen. Sie benannten sich nicht Fraktion, nicht Kollektiv. Sie nannten sich gar nichts. Dabei wäre Tabula Rasa ein guter Name gewesen.
Sie saßen in Küchen und redeten. Ohne Moderation, ohne Handzeichen, ohne Redezeitbegrenzung. Sie stritten – laut, böse manchmal, ohne sich hinterher zu entschuldigen. Es fühlte sich an wie Atmen nach langem Tauchen.
„Wir müssen aufhören, uns selbst zu zensieren", sagte Karim beim dritten Treffen. Er war Journalist, schrieb für ein linkes Magazin, hatte gelernt, jeden Satz dreimal umzuformulieren, bevor er ihn veröffentlichte. „Nicht weil wir reaktionär werden wollen, sondern weil wir klar werden müssen. Wir ersticken an unserer eigenen Rücksichtnahme."
„Und was dann?", fragte Marlene. „Was machen wir konkret?"
Zora hatte darüber nachgedacht. Zu viel vielleicht.
„Wir bleiben drin", sagte sie. „In den Strukturen, in den Gruppen, in den Redaktionen. Aber wir hören auf, uns anzupassen. Wir stellen die unbequemen Fragen. Wir sagen, was alle denken und keiner ausspricht. Wir verschieben den Diskurs – nicht nach rechts, sondern zurück zu dem, worum es eigentlich geht: Klasse, Macht, Eigentum."
„Entryismus", sagte jemand. „Kennt man aus den Siebzigern."
„Nenn es, wie du willst", sagte Zora. „Ich nenn es Notwehr."
Die ersten Monate waren seltsam. Zora ging weiter ins Kollektiv, nickte bei den gleichen Diskussionen, lächelte bei den gleichen Ritualen. Aber sie sprach anders. Nicht provokant, nicht aggressiv – nur präziser, direkter, unversöhnlicher.
Als beim nächsten Plenum jemand vorschlug, eine Safer-Space-Policy für das Buffet zu entwickeln, fragte sie: „Meint ihr nicht, wir sollten uns um die Zwangsräumung in der Rigaer Straße kümmern statt um Triggerwarnungen für Milchprodukte?"
Es wurde still. Jemand räusperte sich. Die Moderation notierte den Einwand und ging zum nächsten Punkt über.
Aber nach dem Treffen kamen drei Leute auf sie zu. „Danke", sagte einer. „Endlich."
So funktionierte es. Langsam, fast unmerklich. Ein Satz hier, eine Intervention da. Keine Revolte, keine Kampfansage – nur eine allmähliche Verschiebung dessen, was sagbar war.
Marlene schrieb einen Text für ihr Magazin über die Entpolitisierung der Klimabewegung. Karim moderierte ein Panel und stellte die Frage, ob Identitätspolitik nicht längst das Instrument der herrschenden Klasse geworden sei, um materielle Konflikte zu verschleiern. Andere verteilten sich auf Gremien, Arbeitskreise, Vorstände – nicht aus Karrieresucht, sondern aus Strategie.
Sie nannten es nicht Unterwanderung. Sie nannten es gar nichts. Sie taten es einfach.
Ein halbes Jahr später saß Zora wieder am gleichen Tresen im Kollektiv. Das Bier war wieder warm. Aber diesmal redeten die Leute neben ihr nicht über Mikroaggressionen. Sie stritten über Streikrecht, über Enteignung, über die Frage, ob man mit der Polizei überhaupt noch verhandeln sollte oder nur noch konfrontieren.
Es war nicht laut. Es war nicht spektakulär. Aber es war anders.
Marlene kam vorbei, bestellte ein Bier, lehnte sich neben Zora an den Tresen. Ihre Wimpern waren lila.
„Funktioniert das gerade?", fragte sie leise.
Zora zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung. Vielleicht. Für den Moment."
„Und wenn wir genauso werden wie die, gegen die wir angetreten sind?"
Zora sah sie an. „Dann", sagte sie, „hoffe ich, dass uns jemand unterwandert."
Marlene lachte. Nicht bitter, nicht zynisch. Hoffnungsvoll.
Draußen fuhr eine Straßenbahn vorbei. Das Licht flackerte. Die Revolution würde nicht kommen, das wusste Zora natürlich. Aber vielleicht konnte man sie trotzdem ein Stück weit herbeilügen. Satz für Satz, Streit für Streit, bis die Lüge zur Wahrheit wurde. Ein bisschen weniger circle jerk. Ein bisschen mehr realer Sozialismus. Weniger Elite, dafür niedrigere Miete. Schon wieder passierte ihr so ein Blödsinnsreim. Sie merkte: Zeit, nach Hause zu gehen.
Sie trank ihr Bier aus und blieb trotzdem sitzen.
Es gab Schlimmeres, als zur falschen Zeit geboren zu sein.
Man konnte auch aufhören zu kämpfen.